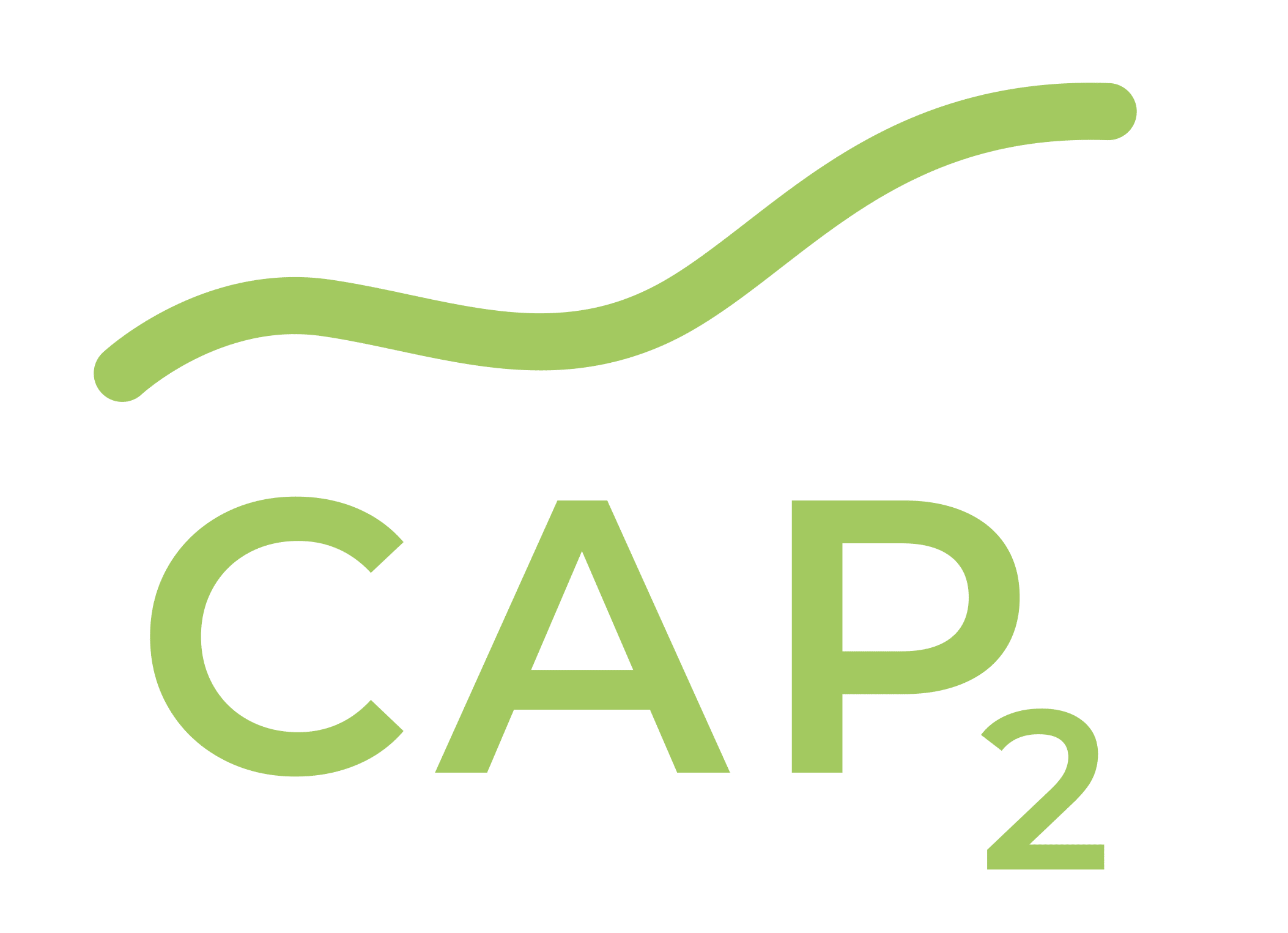Die COP28-Konferenz in Dubai geht langsam dem Ende entgehen, und es ist an der Zeit, ein erstes Fa-zit zu ziehen. Die Hauptaufgabe der Konferenz be-stand darin, eine Bilanz zu ziehen, wo die Welt acht Jahre nach der Unterzeichnung des Pariser Abkom-mens steht – und wie die Länder die massiven Defi-zite zu beheben gedenken, die in der Umsetzung von Zielvorgaben entstanden sind. Gemessen an der CO2-Konzentration in der Atmosphäre sind alle bis-herigen Klimakonferenzen gescheitert. Seit Beginn regelmäßiger Messungen im Jahr 1958 steigt die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre exponen-tiell an, und daran haben die bisherigen Konferen-zen der letzten 20 Jahre wenig geändert. Man könnte allenfalls wohlwollend feststellen, dass die Wachstumsrate in den letzten 20 Jahren im Trend nicht mehr zugenommen hat.
Aber wo stehen wir nun auf der Konferenz mit den Verhandlungen über den Vertragsentwurf?
Einer der wichtigsten Texte, der noch fertiggestellt werden muss, ist der Global Stocktake, eine alle zwei Jahre stattfindende umfassende Bewertung der nationalen Klimaschutzbeiträge der Länder. Diese nationalen Emissionsminderungsstrategien werden alle fünf Jahre gemäß des Pariser Abkom-men von 2015 zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5°C überprüft.
Der von der UNFCCC veröffentlichte Textentwurf enthält eine Reihe von Optionen zur Reduzierung der globalen Emissionen. Darunter befinden sich auch drei Optionen zur Formulierung eines Aus-stiegs aus fossilen Brennstoffen sowie ein Textent-wurf zur Rolle des Privatsektors und der Natur.